Der sichere Weg als Schulleiter oder Schulleiterin zu scheitern ist es andere Schulleiter zu imitieren. Mein erster Vorgesetzter in der Schule war wenig sichtbar und wenn, dann fiel er eher mit bürokratischen Erklärungen auf und ermutigte wenig Experimente. Meine zweite Vorgesetzte sprühte jeden Tag vor neuen Ideen aus Büchern, die sie förmlich zu verschlingen schien und an denen sie alle anderen teilhaben lassen wollte. Konferenzen leitete sie mit leichtem Chaos, viel Erdbeerkuchen und Herzblut. Talentierten Mitarbeitern ließ sie viel Freiraum zur Entfaltung. Das gefiel mir besser. Im Vorbereitungskurs auf die Schulleitungstätigkeit sagte man uns schließlich, wie wichtig „Rollenklarheit“ sei – und darunter hatte man anscheinend die Abgrenzung gegenüber der Lehrer-Rolle und eine gewisse Strenge und Striktheit zu verstehen, was Vorgaben der Dienstordnung anging. Meine ersten Berufserfahrungen als Schulleiter machte ich also vor diesem Hintergrund und scheiterte in den ersten Jahren trotz bester Absichten vielfach. Mitarbeitende bauen kein Vertrauen auf, wo Rollen wie Kleider getragen werden, die nicht dem eigenen Geschmack entsprechen. Rolle und Haltung von schulischen Führungskräften müssen nicht nur kongruent sein, sondern vor allem zur Persönlichkeit und ihrem Umfeld passen. Aber was sind eigentlich „Rollen“?
Eine Rolle lässt sich in Organisationen als eine Kombination der drei Aspekte „Funktion“, „Aufgaben“ und „Position“ beschreiben. Die Funktion einer schulischen Führungskraft kann also z.B. „Stellvertretende Schulleitung“ sein, eine der Aufgaben „Organisation des Vertretungsunterrichts“ und die Position „oberste Führungsebene, weisungsbefugt“. Wenn sich also eine Lehrkraft „rollenklar“ verhält, dann entspricht sie in ihrem Verhalten der Definition der Rolle. Dieser Text wäre an dieser Stelle zu Ende, wenn es so einfach wäre.
Rolle als Frage der Perspektive
Jede Rolle wird von mindestens zwei Seiten definiert nämlich vom Rollen-Inhaber selbst und von jedem Einzelnen im Publikum. So verhält es sich auch im Kino: Ganz sicher spielt jeder James Bond-Darsteller den besten Bond, den er kann und genau entsprechend seiner Rollen-Vorstellungen. Dennoch hat jeder im Publikum eine andere Meinung darüber, ob es ein „guter Bond“ ist, denn jeder verbindet leicht unterschiedliche Rollen-Erwartungen mit der Rolle, von denen der Rollen-Inhaber nicht immer wissen kann. Deswegen lässt sich lange darüber reden, ob Daniel Craig oder Sean Connery der bessere Bond sind. Sind die Aufgaben, die zu einer Rolle gehören, klar beschrieben ist das zwar hilfreich, aber auch hier verbindet jeder möglicherweise unterschiedliche Erwartungen mit den Aufgaben, so dass sich eine genaue Auseinandersetzung darüber lohnt. „Organisation des Vertretungsunterrichts heißt z.B. für die Eltern, dass möglichst jede Stunde fachlich optimal vertreten wird und für manche Lehrkräfte, dass eine Überbelastung durch Vertretungsunterricht vermieden wird und dabei auch Abstriche an der Fachlichkeit gemacht werden können – und so weiter. Gleichzeitig gibt es Vorstellungen des Rolleninhabers davon, welche Erwartungen andere Personen an ihn haben könnten – sozusagen Erwartungs-Erwartungen. Eine Rolle ist also schon von daher mehrdimensional und komplex.
Eine Führungskraft – viele Rollen
Nur selten üben Menschen nur eine einzelne Rolle aus. Ein „Stellvertretender Schulleiter“ ist meistens auch „Lehrkraft für das Fach X“, „Klassenlehrer in der Klasse Y“ und natürlich auch „Vater/Mutter von…“ oder „Freund/Kollege von…“. Auch das sind Rollen, die über „Funktion/Aufgabe/Position“ mal mehr mal weniger klar definiert sind und diese manchmal widersprüchlichen Rollen steigern die Komplexität und erhöhen damit auch die Schwierigkeit rollenklar zu handeln und für die anderen Menschen als Rollen-Inhaber wahrgenommen zu werden.
Position ist mehr als oben oder unten
Auch die Frage der Position kann von Rollen-Inhaber und seinem Gegenüber unterschiedlich wahrgenommen werden. Zwischen den Polen „An der Spitze – Ganz unten“ und „In der Mitte-Ganz Außen“ oder „Vorne-Hinten“ sind viele Definitionen und Beschreibungen denkbar.
Die Frage der Position ist unmittelbar mit der Frage nach der Haltung verknüpft. Klassische Organigramme sind in ein „oben“ für die Führungsebene(n) und ein „unten“ für die Mitarbeitenden unterteilt. Sie folgen der Logik von Entscheidungsmacht. Zu einer solchen Organisation passen Führungskräfte, die selbst Entscheidungen zum Besten der Organisation treffen möchten und davon ausgehen, dass diese auf den jeweils nächsten Ebenen ausgeführt werden. Varianten bestehen darin, dass dabei manche Entscheidungen an Gremien delegiert sind oder Entscheidungen erst nach Beratung in größeren Gremien getroffen werden: Diese Haltung ist also nicht per se unmodern, sondern kann sehr funktional sein nach dem Motto: „Wozu bin ich Schulleiter, wenn ich die Schule nicht leite?“ Eine gute Frage. Schließlich liegt für diejenigen, die den Weg Richtung Schulleitung einschlagen ja vielfach auch der genau darin die Motivation: Entscheidungen selbst treffen können um das System entsprechend den eigenen Werten und Normen mitgestalten zu können. Wozu spricht man auch von „beruflichem Aufstieg“, wenn es kein „oben und unten“ in der Hierarchie gibt?
Eine mögliche Antwort: Vielleicht ließe sich eher davon sprechen, als Führungskraft den Kern der Schule mitzugestalten, sich also vom Außen des operativen Geschäfts Unterricht hin zur Mitte der Sinnstiftung und den gemeinsamen Regeln und Normen zu wenden. Ein solches Führungsverständnis ist also nicht von der Frage von größerer Macht und Einfluss bestimmt, sondern definiert sich durch die andersartige Beschäftigung mit der gemeinsamen Organisation, durch andere Aufgaben, nicht durch Hierarchie-Unterschiede. Wer von innen nach außen wirkt hat aus dieser Perspektive immer das Außen im Blick und damit immer auch das operative Kerngeschäft Unterricht, das den Lehrkräften anvertraut ist. Wenn Lehrkräfte sich ebenfalls nicht hierarchisch nach oben wenden, sondern zur Mitte hin, haben sie umgekehrt immer die gemeinsamen Ziele im Blick und weniger eine weisungsbefugte Führungskraft.
Zuletzt kann auch die Vorstellung helfen, von hinten zu führen, sich „hinter seine Leute zu stellen“ und ihnen „den Rücken zu stärken“, vielleicht sogar ein wenig „Anschub geben“. Es gibt auch Situationen in denen Führungskräfte vorne stehen. Nicht nur um sich „vor die Mitarbeitenden zu stellen“ und sie vor ungerechtfertigten Ansprüchen zu schützen, sondern auch um die gelungene Arbeit der Schule nach außen zu präsentieren, als Gesicht der Schule in der Öffentlichkeit.
Die Frage der Position einer schulischen Führungskraft kann also durchaus dynamisch sein. Optimal erscheint ein Handeln aus der Mitte heraus, mit Flexibilität nach vorne und hinten und eine Aktivierung der Achse „oben-unten“ nur dort wo es aus disziplinarischen Gründen unerlässlich ist.
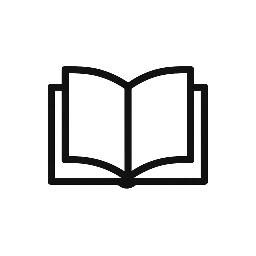

Schreibe einen Kommentar