Sie können tausende von Emails schreiben und zahlreiche Vorträge in Konferenzen halten, ohne jemals in echten Kontakt mit Ihrer Schule gekommen zu sein, denn die direkte Begegnung mit Menschen ist durch nichts zu ersetzen.
Gespräche sind die einzige Möglichkeit, uns als Führungskräfte in der Schule über unsere Vorstellungen mit den Mitarbeitenden auszutauschen. Es gibt zahlreiche hervorragende Ratgeber dazu, die Gesprächsformate differenzieren und Vorschläge für entsprechende Strukturen und hilfreiche Fragen machen. Es kann dabei der Eindruck entstehen, als wenn Führungskräfte Gespräche derart aktiv gestalten könnten, dass die weiteren Gesprächsteilnehmenden nur entsprechend folgen müssen, in dem sie sich erwartungsgemäß verhalten oder antworten. Es ist dann nicht verwunderlich, dass nach einem solchen Gespräch ein ungutes Gefühl zurückbleibt, so als ob statt einer menschlichen Begegnung eine den Vorgaben entsprechende Turnübung ausgeführt worden sei. Dabei gilt auch hier, dass jedes Gespräch nur unter der Voraussetzung auf beiden Seiten als produktiv und positiv wahrgenommen wird, wenn die Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Anerkennung und Struktur bedient werden. Woran liegt es dann, dass bei einer Vielzahl von Gesprächen im beruflichen Kontext Unzufriedenheit auf mindestens einer Seite zurückbleibt?
Dafür ist zunächst notwendig zu verstehen, was in Gesprächen jenseits des sachlichen Kerns geschieht und welche Bedeutung hohe Bedeutung die ersten beiden Gesprächsphasen „Kontakt“ und „Kontrakt“ und auch der „Abschluss“ gegenüber der zentralen inhaltlichen Phase haben.
Verschieben Sie den Fokus weg von sich selbst auf Ihr Gegenüber: Kommen Sie in Kontakt
Gerade als frisch ernannte Führungskraft ist man sich häufig noch des Neuen an der eigenen Rolle bewusst. Dadurch verwendet man auch in Gesprächen einige Aufmerksamkeit darauf, so zu sprechen oder sich zu verhalten, wie es der eigenen Vorstellung von der neuen Rolle entspricht. Das ist ein normaler Prozess während des Ankommens in der Rolle, behindert aber das Einlassen auf andere Personen im Gespräch. Verschieben Sie daher so schnell wie möglich den Fokus weg von sich selbst und lenken ihn auf ihr Gegenüber. Kommen Sie direkt zu Beginn des Gesprächs in einen echten Kontakt. Das gelingt z.B. durch einen kurzen Blick-Kontakt, offene Mimik und eine möglichst offene Einstiegsfrage: „Na, wie geht’s?“ „Wie war es heute bisher?“ etc. Hören Sie anschließend gut zu – dem offen Gesagten und allen Unter- und Zwischentönen, die sich in Gestik, Mimik und Prosodie zeigen. Bleiben Sie mit allen Sinnen aufmerksam und erliegen Sie nicht der Versuchung, während des Zuhörens bereits über Ihre Antwort oder nächste Frage nachzudenken – schon gar nicht über die Frage, wie Sie gerade in Ihrer Rolle als Führungskraft wirken. Die hier gemeinte und in der Ratgeber-Literatur häufig auch so benannte „Kontakt-Phase“ ist vor allem ein Moment der authentischen atmosphärischen Kontaktaufnahme zu einem anderen Menschen und eben keine „Phase“, die notwendigerweise abgehakt werden kann. Sie ist genau dann vorbei, wenn dieser Kontakt spürbar wurde – nach einer Sekunde oder auch einer Minute. Alles, was Sie in diesem Kontakt spüren, auch mögliche negative Schwingungen bei sich selbst oder der anderen Person, ist von hoher Bedeutung für den weiteren Verlauf. Sie haben die Gelegenheit zu erspüren, ob Ihr Gegenüber z.B. eher hilfesuchend/unsicher, kritisch/selbstgefällig oder aufgeschlossen/neugierig in das Gespräch kommt.
Vereinbaren Sie miteinander Thema und Ablauf des Gesprächs
Nur weil man die Verabredung zu einem gemeinsamen Gespräch zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Thema getroffen hat, heißt das nicht, dass beide Teilnehmenden auch identische Vorstellungen von Thema und Verlauf des Gespräches haben. Gar nicht so selten ist es, dass auch die Leitungskräfte nicht genau genug wissen, was ihr konkretes Ziel im Gespräch ist. Daher sollten Sie sich dafür immer vor jedem wichtigen Gespräch mindestens 10 Minuten Zeit nehmen. Aber auch wenn das gegeben ist, ist es höchst wahrscheinlich, dass Ihr Gegenüber mit einem anderen Strauß von Gedanken, Wünschen, Interessen, Vorstellungen, Haltungen und Emotionen zum entsprechenden Thema zum Termin erscheint. Vereinbaren Sie daher als zweiten Schritt zunächst das Gesprächsthema miteinander im Sinne einer Annäherung der unterschiedlichen Gedanken-Sets. Fragen Sie z.B. „Was stellen Sie sich heute unter unserem Thema XY vor?“. „Mit welchen Ideen zu unserem Stichwort „XY“ sind Sie heute zu mir gekommen?“. Hören Sie mit allen Sinnen zu, was Sie erfahren. Teilen Sie anschließend offen Ihre eigenen Vorstellungen mit: „Ich höre den Wunsch nach X und mir ist außerdem Y bei diesem Thema wichtig. Sollen wir nacheinander darüber sprechen oder lassen sich beide Aspekte miteinander verbinden?“. Fragen Sie aktiv nach, welche alternativen Vorstellungen die Mitarbeitenden haben und gehen Sie darauf ein. Vor allem: Halten Sie sich im Anschluss an die entsprechenden Verabredungen.
Beachten Sie, dass es nur selten ausschließlich um die Sachebene des Gesprächs geht und dass die Mitarbeitenden oft unbewusst teilweise konträre Ziele verfolgen. Bleiben Sie fokussiert und entscheiden Sie bewusst, wie Sie reagieren möchten, wenn das Gespräch unerwartete Wendungen nimmt.
Nachdem Kontakt aufgenommen ist und Klarheit über Rahmen und Ziele des Gesprächs einvernehmlich hergestellt ist, sollte man meinen, dass nun sachlich und zielstrebig der inhaltliche Teil des Gesprächs erfolgen kann. Möglicherweise gibt es Vereinbarungen zu einem gemeinsamen weiteren Vorgehen und einem nächsten Treffen. Sie sollten keinesfalls vergessen den Abschluss des Gespräches zu markieren und ein freundliches und natürliches Ende zu finden.
Mindestens die Hälfte aller Gespräche verlaufen erfahrungsgemäß nicht so und das liegt daran, dass die psychologische Ebene weitaus wirkmächtiger als die Sachebene ist. Jede Führungskraft benötigt ein zumindest grundlegendes Verständnis davon, besser noch ein ausführliches entsprechendes Training, damit sie versteht, was dort vor sich geht und besser noch entsprechend reagieren kann.
Betrachten Sie jedes Gespräch als ein Fenster zur Persönlichkeit des Anderen.
Alle Mitarbeitenden bringen Prägungen mit, die sie in frühester Kindheit erworben haben. Modellhaft und ausführlich beschreibt dies Eric Berne im Kontext der von ihm mit begründeten Transaktionsanalyse und zahlreiche ihm bis heute nachfolgenden Autoren und Praktiker, deren ausführliche Erläuterungen und Beispiele unbedingt zum Studium empfohlen werden. Eine gewisse auf die eigene berufliche Praxis bezogene psychologische Grundbildung hilft in Gesprächen sehr zu erkennen, wann Gespräche nicht mehr produktiv sind und sie dann auf die produktive Ebene zurückzuholen oder zu beenden.
Im Alltag von Führungskräften an Schulen ist es nicht erforderlich, die tieferen Zusammenhänge zu erfassen, die Mitarbeitende dazu bringen, ein bestimmtes beobachtbares Verhalten im Gespräch zu zeigen.
Besonders sinnvoll kann es aber für den schulischen Alltag sein, typische Rollen zu kennen, die Personen in Gesprächen einnehmen und zusätzlich typische unfruchtbare Gesprächsmuster, die im Alltag immer wieder ablaufen – Berne bezeichnet diese als „Spiele der Erwachsenen“, weil es ähnlich wie bei einem Spiel Gewinner und Verlierer gibt und sie keinen eigenen objektiven Nutzen haben. Dennoch spielen Gesprächsmuster dieser Art eine große Rolle im Alltag von Führungskräften an Schulen.
Häufige unfruchtbare Gesprächsmuster: „Spiele der Erwachsenen“
Drei Rollen werden in diesen Gesprächen unabhängig von der Zahl der Teilnehmenden eingenommen: Verfolger, Opfer und Retter. Summer (1990) hat zwei weitere Rollen beschrieben, die in Schulen relevant sind: Das sind die Zuschauer, die es sehr häufig in Konferenzen oder im Lehrerzimmer gibt. Außerdem ist es die Bühnenmanagerin/der Bühnenmanager, denn die Bedingungen für eine Interaktion werden häufig durch jemand anders geschaffen, z.B. durch eine Konferenzeinladung und eine dort vorgegebene Methode des Austauschs.
Die Rollen beschreiben aufwertendes oder abwertendes Verhalten in der Interaktion. „Verfolger“ werten selbstgefällig andere Personen ab und sich selbst u.a. dadurch auf. „Opfer“ werten sich selbst ab und halten andere Personen verunsichert für überlegen. „Retter“ werten sich selbst auf, weil sie den Eindruck haben anderen helfen zu können und verstärken das durch die Hilfe selbst. Andere Personen, die ihre Hilfe benötigen werten sie ab und ebenso die „Verfolger“, deren Verhalten sie missbilligen. Insgesamt gibt es also mehr Abwertung als Aufwertung in diesen typischen Konstellationen.
Dieser Überschuss von Abwertung gegenüber Aufwertung anderer Personen ist ein entscheidender Faktor für das Klima der Zusammenarbeit in unseren Organisationen. Die Zuschauer bilden einen wichtigen Einfluss, weil sie u.a. beeinflussen, wer welche Rollen (stellvertretend) einnimmt. Dies ist beispielsweise beim Redeverhalten in Konferenzen zu beobachten. Der Bühnenmanager hat bewusst oder unbewusst durch die geschaffenen Rahmenbedingungen beeinflusst, welche Interaktionen zustande kommen und welche nicht. Schulleitungen und andere pädagogische Führungskräfte wie die Zuständigen für die Koordinierenden der Schul- und Unterrichtsentwicklung befinden sich oft unbewusst in dieser Rolle.
Beispiel für unfruchtbare Muster
Die typischen unfruchtbaren Gesprächsmuster, die im Alltag von Führungskräften beendet und produktiv gemacht werden sollten, beginnen in der Regel mit einer abwertenden Aussage, entweder von sich selbst aus der Opfer-Rolle heraus, von anderen aus der Verfolger-Rolle heraus oder von anderen aus der Retter-Rolle heraus.
Beispiele:
Lehrkraft zu Schulleitung aus der Opfer-Rolle: „Ich schaffe diese Berge von Klassenarbeiten nicht mehr so wie früher und wie die jüngeren Kollegen.“
Die eigene Arbeitsleistung wird im Vergleich zu früher und zu jüngeren Kollegen abgewertet.
Lehrkraft zu Schulleitung aus der Verfolger-Rolle heraus: „Der Terminplan für das kommende Schuljahr lässt überhaupt keinen Raum mehr für unsere eigentliche pädagogische Arbeit.“
Die planerische Arbeit der Schulleitung wird abgewertet und behauptet, dass andere Aspekte der Arbeit nicht genügend berücksichtigt wurden.
Lehrkraft zur Schulleitung aus der Retter-Rolle heraus: „Sie sehen in den letzten Wochen ganz schön gestresst aus – kein Wunder bei Ihrer ganzen Arbeit. Machen Sie eigentlich auch mal Pause?“
Die Belastbarkeit der Schulleitung wird abgewertet und in ein Gewand von Mitleid und Ratschlägen gekleidet.
Trifft ein derartiger Gesprächsauftakt auf eine komplementäre Haltung entwickelt sich das Gespräch weiter.
Im letzten Beispiel könnte die schulleitende Person zum Beispiel im Folgenden sagen:“Ja, viel zu wenig Pause ehrlich gesagt, es ist ja immer etwas zu tun, deswegen ist ganz schön viel Stress“.
So wird die abwertende Zuschreibung angenommen und damit können weitere Ratschläge und mitleidige Kommentare erfolgen. Das kann immer so weiter gehen, typischerweise tut es das aber nicht. Meist werden ab einem bestimmten Zeitpunkt die Rollen gewechselt.
Die schulleitende Person könnte sagen: „Wissen Sie, ich bin ja aber nicht der Einzige der viel zu tun hat – bei Ihnen sehe ich auch schon lange, dass etwas nicht stimmt, so spät wie sie jeden morgen zum Unterricht kommen.“
Das wäre ein krasser Wechsel aus der Opfer in die Verfolger-Rolle. Die Führungskraft wertet nun das dienstliche Verhalten der Lehrkraft deutlich ab. Das wird diese so nicht erwartet haben und es stellt sich erstmal Verblüffung und ein ungutes Gefühl ein. Möglicherweise beendet das den Austausch vielleicht folgt aber nun eine neue Interaktion unter anderen Vorzeichen, in der die Lehrkraft sich verteidigt (Opfer-Rolle) und die Führungskraft weiter insistiert (Verfolger-Rolle) oder Ihrerseits in die Retter-Rolle schlüpft und Verständnis zeigt und Hilfe anbietet. Möglicherweise mischt sich aber auch eine dritte Person aus einem eventuellen Kreis von Zuschauern an um die die Retter-Rolle zu übernehmen und ihrerseits das Verhalten der Schulleitung abzuwerten: „Es wird ja wohl noch mal einer zu spät kommen dürfen, ohne dass die Schulleitung das direkt minutiös protokolliert“ (Der Schulleitung wird also vorgeworfen, nicht das erforderliche Fingerspitzengefühl zu besitzen). Am Ende fühlen sich alle schlecht – aber es gab Aufregung und Emotionen – und das ist psychologisch betrachtet ein akzeptabler Gewinn. Negative Aufmerksamkeit zählt auch.
Unfruchtbare Gesprächsmuster im Überblick
Je nach Auftakt des Austausches kann man die Spiele nach Verfolger-Spielen, Opfer-Spielen oder Retter-Spielen ordnen und sie werden in Schulen ständig und mit Hingabe gespielt, weil es um Abwertung geht und Abwertung in jeglicher Form liegt leider in der DNA der meisten Schulen und daher auch der darin arbeitenden Menschen, die ja ebenfalls in Schulen erzogen wurden. Das hat damit zu tun, dass die Haltung, mit der Leistung bewertet wird auf andere Situationen übertragen wird.“ Ich bin o.k. – Du bist nicht o.k.“ ist kurz gefasst eine Grundhaltung von vielen Lehrkräften, die sie auch in Situationen und Gesprächen außerhalb der eigentlichen Bewertung von Schülerleistungen und manchmal auch im privaten Kontext einnehmen. Zugleich ist das auch eine Grundposition von vielen Schulleitungen, die sich für weiser, besser ausgebildet und ihrem Team generell überlegen halten. Schulleitende können also überlegen, ob sie genauer überlegen möchten, welche Rolle sie in einer Interaktion gerade einnehmen und ob diese fruchtbar und hilfreich für den weiteren Verlauf des Gespräches ist.
Auswege aus unproduktiven Mustern
Wie kommt man aus den eingefahrenen und unfruchtbaren Interaktionsmustern heraus, wenn man bemerkt, dass sich ein Gespräch nicht mehr auf der produktiven Ebene befindet und man sich unbewusst in einem der unproduktiven Muster verfangen hat? Helfen können:
Unerwartete Antworten
Strukturierung aus dem Erwachsenen-Ich
Direktes Ausdrücken von Bedürfnissen und Gefühlen statt Manipulatives Agieren
Fragen nach Erwartungen des Anderen statt Reaktion
Bewusstes Überhören der psychologischen Ebene und Agieren aus dem Erwachsenen-Ich
Bewusstes Wahrnehmen und Thematisieren der psychologischen Ebene
Oder erst gar nicht:
Retter spielen, wenn gar keine Unterstützung benötigt und erbeten wird.
Verfolger spielen, und keine Leute kritisieren, die keine Kritik zur Weiterentwicklung brauchen.
Opfer spielen, wenn man selbst gar nicht hilflos ist
Damit Gespräche in Schulen insgesamt weniger von Interaktionen in den genannten Rollen geprägt werden, hilft es mehr Aufwertung als Abwertung in alle Interaktionen einzubringen. Eine echte Kultur der Anerkennung und Beachtung ist dafür wesentlich: „Catch them doing it right“.
Diese Beachtung sollte sich nicht nur auf Leistungen beziehen, sondern auch auf die Qualität des Austauschs und des positiven Miteinanders.
„Gespräche verstehen“ bedeutet an dieser Stelle also im Wesentlichen:
dass man sich freuen kann, wenn ein Austausch richtig gute Gefühle und Ergebnisse auf allen Seiten haben konnte.
Dass man nicht enttäuscht sein muss, wenn dies nicht gelungen ist, denn die Wahrscheinlichkeiten für einen ungelenken Gesprächsverlauf sind erst einmal höher
Dass es sich lohnen kann, wichtige Gespräche mit großer Aufmerksamkeit für die psychologischen Rollen und Gesprächsmuster zu führen, damit sie wieder auf eine produktive Ebene zurückgeholt werden können.
Dass man gelassen und wertschätzend mit den anderen Menschen umgehen darf, denn nur das eigene Gesprächsverhalten lässt sich beeinflussen.
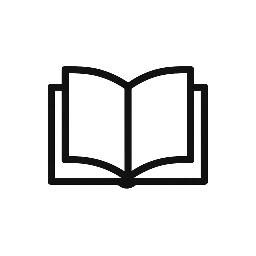

Schreibe einen Kommentar