Viele Lehrkräfte verbinden mit der Arbeit in Teams Erinnerungen an die Gruppenarbeit in der eigenen Schulzeit: Nichts geht voran, am Ende macht man doch alles alleine zu Hause und faule Mitschüler bekommen zum Dank auch noch die gleiche Leistungsnote. Nein Danke, mag manche Lehrkraft denken und lehnt die Arbeit in Teams als Fortsetzung der Erfahrung von Zeitverschwendung und fehlender Anerkennung der eigenen Leistung ab. Aus dieser Haltung heraus ermutigen Sie auch die Schülerinnen und Schüler im eigenen Unterricht nicht zu effektiver Teamarbeit – und hier schließt sich dann der Teufelskreis.
Je nach Ausgangssituation einer Schule gilt es daher, die Zusammenarbeit in Teams grundlegend zu entwickeln oder aber die bestehenden Teamstrukturen im Sinne einer Optimierung weiterzuentwickeln. Letzteres ist einfacher und mit Hilfe einiger Tools und Hilfestellungen für die Mitarbeitenden zu erreichen.
Im ersten Fall empfiehlt es sich, eine eigene sehr klare Vorstellung zu haben, warum das Vorhaben Lehrkräfte strukturiert in Teams zusammenarbeiten zu lassen, angegangen werden soll. Dort, wo Teamstrukturen nur schwach ausgeprägt sind, ist trotzdem eine Arbeitsstruktur vorhanden und häufig sind damit die meisten Beteiligten zufrieden. Sollte es also keine von außen oder innen kommende gravierende Irritation des Systems geben, wird es nicht einfach sein ein eingeschwungenes Arbeitsmuster in der Schule zu verändern. Schulleitende kennen natürlich die Qualitätstableaus für Schulen, in denen Teamarbeit der Lehrkräfte eine wichtige Rolle spielt. Das alleine wird aber in einer Expertenorganisation wie der Schule die Mitarbeitenden nicht überzeugen, bestehende Gewohnheiten aufzugeben. Im Gegenteil: Dass Schulleitende vorgeben, wie (zusammen) zu arbeiten ist und das auch noch evtl. mit dem Hinweis auf Qualitätstableaus kann bei vielen Mitarbeitenden eher zu Widerstand führen. Daher muss der Wert von Teamarbeit zunächst für die Schulleitenden selbst überzeugend definiert sein. Anschließend muss aber auch darüber nachgedacht werden, welchen Mehrwert Teamarbeit für die Lehrkräfte haben kann, denn der Wert für die Schulleitung besteht möglicherweise in unterschiedlichen Vorteilen, auch wenn es Überschneidungen gibt.
| Vorteile aus Leitungsperspektive |
| Multiplikation guter Ideen |
| Qualitätssicherung durch gegenseitigen Abgleich |
| Minderleistende können sich an Stärkeren orientieren |
| Verbindlichkeit getroffener Vereinbarungen wird abgesichert |
| Verlässlichkeit für Schüler:innen steigt, Vergleichbarkeit der Erwartungen und (Reihenfolge) der Unterrichtsinhalte |
| Multiperspektivität bei pädagogischer Beratung von Schüler:innen und Eltern |
| Verbesserung von Onboarding-Prozessen neuer Lehrkräfte |
| (weitere) Vorteile aus Lehrkräfteperspektive |
| Zeitliche Entlastung durch Arbeitsteilung |
| Sicherheit durch Vergleichbarkeit |
| Anerkennung von eigenen Ideen, die von anderen Lehrkräften übernommen/adaptiert werden |
| Entwicklung neuer Ideen durch Austausch (1+1=3) |
Insbesondere die Vorteile in Bezug auf Standardisierung, Qualitätssicherung und Verbindlichkeit, die das Arbeiten in Teams mit sich bringt, stehen im Widerspruch zum Bedürfnis vieler Lehrkräfte möglichst autonome Entscheidungen treffen zu können und dem Umstand, dass Minderleistende ein Interesse daran haben, dass ihre Minderleistungen nicht bemerkt werden.
Besser ist es daher, die Aspekte in den Vordergrund zu stellen, die das meiste Potenzial aus Sicht der Lehrkräfte haben. Angesichts von häufiger Eltern-Kritik die Sicherheit zu haben, sich auf Team-Entscheidungen berufen zu können, ist aus dieser Perspektive beispielsweise ein großer Vorteil. Die Frage der zeitlichen Entlastung wird dagegen immer wieder in Frage gestellt, da das Arbeiten in Teamstrukturen und der Abgleich und Austausch miteinander zunächst zusätzliche Zeit kostet. Bei der allmählichen Einführung von Teamstrukturen ist also zunächst unbedingt darauf zu achten, dass nicht zusätzliche Termine für die Zusammenarbeit angesetzt werden, sondern die vorhandenen Besprechungs-Termine alternativ genutzt werden. So können Team-Zeiten im Rahmen von Lehrerkonferenzen stattfinden. Auch Schulinterne Lehrerfortbildungen können Team-Zeiten enthalten, ebenso etablierte Termine wie Dienstbesprechungen zum Schuljahresende oder Schuljahresanfang, solange sie nicht zusätzlich erscheinen. Funktionierende Gruppierungen werden bei Bedarf selbst nach zusätzlichen zeitlichen Ressourcen suchen und ggf. auch die Leitung um Unterstützung dabei bitten. Auf diese Weise entwickelt sich allmählich eine stärkere Teamkultur. Dabei verhält es sich wie bei einer neu angelegten Rasenfläche: Es gibt Stellen, wo es ganz schnell grün wird, an anderen Stellen dauert es lange und manche bleiben erst einmal kahl und es muss nachgesät werden. Aber nach entsprechend langer Zeit – in der Schule in Jahren gerechnet – etablieren sich verbindliche Formen der Zusammenarbeit in der Art und Weise, dass die Vorteile aus Leitungs- und Lehrkräfte-Perspektive nicht mehr unterschiedlich sondern einheitlich betrachtet werden können. Voraussetzung dafür ist dabei auch das vorbildhafte Handeln der Leitungspersonen in der Schule. Die Teamstrukturen, in denen die Schulleitenden selbst beteiligt sind, wirken vorbildhaft für alle anderen Personen im System.
10 Schritte bei der Verstärkung von Teamarbeit in der Schule
Identifizieren Sie die bestehenden und funktionierenden Teams an der Schule. Mindestens eines gibt es immer.
Zeigen Sie Interesse für die Gelingensbedingungen dieser Zusammenarbeit. Wertschätzen Sie diese strukturierte Zusammenarbeit explizit und fragen Sie aktiv nach, welche Vorteile die Beteiligten selbst sehen und welche Unterstützung sie sich seitens der Leitungsebene darüber hinaus wünschen.
Lassen Sie Ihre Wertschätzung für dieses Team nicht unentdeckt sein. Erzählen Sie hier und da davon.
Ändern Sie ihr eigenes Wording und unterscheiden Sie zwischen lose zusammenarbeitenden Gruppierungen und strukturierten Teams. Zeigen Sie dadurch, dass nicht alles ein Team ist, nur weil es aus mehreren Personen besteht.
Fangen Sie in ihrem eigenen Leitungsteam an die Zusammenarbeit zu professionalisieren und nutzen Sie dazu z.B. Werkzeuge wie das „Teambarometer“ und andere wie von Elmar Philipp im Buch „Multiprofessionelle Teamentwicklung“ vorgeschlagen (Beltz: 2024). Nehmen Sie Widerstand dagegen am besten mit Humor.
Stellen Sie diese Werkzeuge auch in anderen Teams vor, an denen sie beteiligt sind. Belassen sie deren Nutzung optional, aber zeigen Sie sich ehrlich überzeugt von deren Nutzen und Möglichkeiten – falls Sie es sind.
Stellen Sie zunehmend Zeitfenster zur Teamarbeit bereit, wo sonst Plenumsaktivitäten stattgefunden haben. Diejenigen, die in diesen Fällen allein bleiben, sollen eingeladen sein, sich als „wache Geister“ als Gast in einem bestehenden Team umzusehen.
Beobachten Sie die Entwicklung und ob die „wachen Geister“ weniger werden. Beobachten Sie, ob Tools zur strukturierten Teamarbeit genutzt werden. Seien Sie immer und weiterhin Vorbild in Bezug auf die Glaubwürdigkeit des Wertes von Teamarbeit und gestalten Sie die Leitungsarbeit bewusst im Team.
Wertschätzen und loben Sie jeden kleinen ersten Schritt, der in Richtung strukturierter Zusammenarbeit gemacht wird. Bleiben Sie sehr geduldig.
Weiten Sie Zeitfenster für die Zusammenarbeit aus, z.B. auch durch die Nutzung von digitalen und asynchronen Formate, so dass Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung mit Teamentwicklung kombiniert werden.
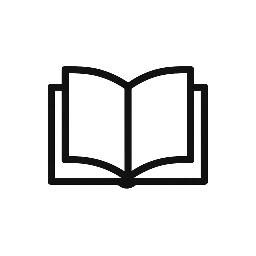

Schreibe einen Kommentar